 ĦķΩ7
ĦķΩ7

GEDICHTE VOM SYMPOSIUM
"POSTHUME GÜSSE"
im ARP MUSEUM BAHNHOF ROLANDSECK
 ĦķΩ7
ĦķΩ7

KLAUSENS LIVE-DICHTUNG
ERKENNT DIE WELT, WIE
SIE ANDERS NICHT IST. (Klausens hat
den Genitiv implantiert im Namen, er braucht keinerlei Apostroph dann.)


Am
8.9.2008 versammelten sich im ARP MUSEUM in ROLANDSECK, welches
wiederum zu REMAGEN gehört, einige Fachleute, um zu klären,
welche
Abgüsse und Güsse von Skulpturen denn in ein Museum
gehören ... und
welche nicht. Zudem fragten sie, die Damen und Herren: Wenn ja, wie
denn? Was muss bei / an der Skulptur informativ dranstehen?
KLAU/SENS hat in seiner gütlichen Güte als Künstler
allen Schaffens dieses Symposium ehrlich
begleitet und die Welt mit seinen LIVE-GEDICHTEN (siehe dazu: www.klausens.com/klausens_live_dichten_theorie.htm)
neu abgegossen.
jetzt.sueddeutsche.de/texte/anzeigen/446755
DIE PLATTFORM jetzt.de wurde allerdings 2016 schnöde von der
SÜDDEUTSCHEN ZEITUNG verändert. Alle Blog-Beiträge der
vielen Menschen wurden im Rahmen dieser "Reform" einfach mal komplett
weggelöscht.
Weiter unten finden
sich ausgewählte Presseartikel und Pressemitteilungen.


GUSSTOS
Es ist eine Sache mit
Dem Willkommen Großer
Bahnhof Rolandseck
Mit den großen Güssen
Aber eine ganz andere
8.9.2008, Montag, Arp Museum Bahnhof Rolandeck (Remagen), LIVE beim Symposium "Posthume Güsse" geschrieben. Genaue Angabe der Teilnehmer auf dem Podium siehe weiter unten. Es spricht Prof. Dr. Klaus Gallwitz, Direktor des "Arp Museum Bahnhof Rolandseck". Copyright Klau|s|ens in allen Schreibwaisen und -weisen, u.a. als Klau*s*ens oder Klau#s#ens oder Klau+s+ens.
ACHTUNG: Dieses Gedicht ist ein ZITATGEDICHT. Zu den Zitatgedichten von Klausens siehe: https://www.klausens.com/zitatgedichte.htm
© Klau|s|ens
8.9.2008, Montag, Arp Museum Bahnhof Rolandeck (Remagen), LIVE beim Symposium "Posthume Güsse" geschrieben. Genaue Angabe der Teilnehmer auf dem Podium siehe weiter unten. Es spricht Prof. Dr. Klaus Gallwitz, Direktor des "Arp Museum Bahnhof Rolandseck", der gerade auf die zwei Schreibweisen des Wortes "posthum" hinweist. Copyright Klau|s|ens in allen Schreibwaisen und -weisen, u. a. als Klau*s*ens oder Klau#s#ens oder Klau+s+ens.
© Klau|s|ens
8.9.2008, Montag, Arp Museum Bahnhof Rolandeck (Remagen), LIVE beim Symposium "Posthume Güsse" geschrieben. Genaue Angabe der Teilnehmer auf dem Podium siehe weiter unten. Es spricht Prof. Dr. Gerhard Pfennig über das Urheberrecht. Copyright Klau|s|ens in allen Schreibwaisen und -weisen, u. a. als Klau*s*ens oder Klau#s#ens oder Klau+s+ens.
© Klau|s|ens
8.9.2008, Montag, Arp Museum Bahnhof Rolandeck (Remagen), LIVE beim Symposium "Posthume Güsse" geschrieben. Genaue Angabe der Teilnehmer auf dem Podium siehe weiter unten. Es spricht Dr. Gert Reising über die ARP-Nachahmungen, -Nachhauungen, -Nachmachungen, etc., z.B. der weiße "STERN" aus Marmor, der offenbar 12-fach oder 12 mal existiert. Aber welcher gilt? Welcher hat Geltung? Welcher ist (noch) von ARP? Copyright Klau|s|ens in allen Schreibwaisen und -weisen, u. a. als Klau*s*ens oder Klau#s#ens oder Klau+s+ens.
zusätzlich von KLAUSENS
hinzugefügt: ZITAT SPIEGEL-WISSEN vom 16.3.1998:
wissen.spiegel.de/wissen/dokument/dokument.html?id=7838758&top=SPIEGEL
Auf Nachfragen kam heraus, daß der "Stern", ebenso wie noch weitere sieben Marmor-Werke, rund zweieinhalb Jahrzehnte nach dem Tod des Künstlers entstanden ist, angefertigt im Auftrag des Vereins "Stiftung Hans Arp und Sophie Taeuber-Arp". Der fühlt sich, da im Besitz der Urheberrechte, befugt, jedwede Arp-Skulptur in Marmor zu kopieren, solange es davon noch kein Exemplar in diesem Werkstoff gibt. Beim "Stern" indes könnte die Voraussetzung entfallen. Neuerdings hat das Fernsehmagazin "Titel, Thesen, Temperamente" bei einem Sammler in Baltimore ein, wie es scheint, älteres Marmor-Stück gleicher Form aufgespürt, offenbar zwei weitere sind während der letzten Jahre bei Auktionen angeboten worden. Welchen Glanz kann demnach der rheinland-pfälzische "Stern" noch ausstrahlen? Muß er nicht aus dem leicht paradoxen Ehrenrang eines postumen Originals zur schnöden Reproduktion degradiert werden - oder gar schlicht zur Fälschung?
© Klau|s|ens
8.9.2008, Montag, Arp Museum Bahnhof Rolandeck (Remagen), LIVE beim Symposium "Posthume Güsse" geschrieben. Genaue Angabe der Teilnehmer auf dem Podium siehe weiter unten. Es spricht Dr. Eduard Beaucamp. Copyright Klau|s|ens in allen Schreibwaisen und -weisen, u. a. als Klau*s*ens oder Klau#s#ens oder Klau+s+ens.
ACHTUNG: Dieses Gedicht ist ein ZITATGEDICHT. Zu den Zitatgedichten von Klausens siehe: https://www.klausens.com/zitatgedichte.htm
© Klau|s|ens
8.9.2008, Montag, Arp Museum Bahnhof Rolandeck (Remagen), LIVE beim Symposium "Posthume Güsse" geschrieben. Genaue Angabe der Teilnehmer auf dem Podium siehe weiter unten. Es spricht gerade Prof. Dr. Gerhard Pfennig und zeigt ein Plakat zu HANS ARP mit einer (verfälschten) ARP-Skulptur in die Luft. Dazu KLAUSENS stiller Kommentar: "Was stimmt? Was stimmt nicht? Was ist wahr? Was nicht? So wird man ewig fragen, immer wieder! Immer wieder neu." - Copyright Klau|s|ens in allen Schreibwaisen und -weisen, u. a. als Klau*s*ens oder Klau#s#ens oder Klau+s+ens.
© Klau|s|ens
8.9.2008, Montag, Arp Museum Bahnhof Rolandeck (Remagen), LIVE beim Symposium "Posthume Güsse" geschrieben. Genaue Angabe der Teilnehmer auf dem Podium siehe weiter unten. Es spricht gerade sehr erregt eine Dame vom Arp-Verein, Frau Wild (?) - Copyright Klau|s|ens in allen Schreibwaisen und -weisen, u. a. als Klau*s*ens oder Klau#s#ens oder Klau+s+ens.
© Klau|s|ens
8.9.2008, Montag, Arp Museum Bahnhof Rolandeck (Remagen), LIVE beim Symposium "Posthume Güsse" geschrieben. Genaue Angabe der Teilnehmer auf dem Podium siehe weiter unten. Es spricht gerade Prof. Dr. Henrik Hanstein über die unterschiedlichen Begriffe vom Orignal (Oriiginalität) und der (Bewertungs-)Kraft des Marktes - Copyright Klau|s|ens in allen Schreibwaisen und -weisen, u. a. als Klau*s*ens oder Klau#s#ens oder Klau+s+ens.
© Klau|s|ens
8.9.2008, Montag, Arp Museum Bahnhof Rolandeck (Remagen), LIVE beim Symposium "Posthume Güsse" geschrieben. Genaue Angabe der Teilnehmer auf dem Podium siehe weiter unten. -- Copyright Klau|s|ens in allen Schreibwaisen und -weisen, u. a. als Klau*s*ens oder Klau#s#ens oder Klau+s+ens.
© Klau|s|ens
8.9.2008, Montag, Arp Museum Bahnhof Rolandeck (Remagen), LIVE beim Symposium "Posthume Güsse" geschrieben. Genaue Angabe der Teilnehmer auf dem Podium siehe weiter unten. -- Copyright Klau|s|ens in allen Schreibwaisen und -weisen, u. a. als Klau*s*ens oder Klau#s#ens oder Klau+s+ens.
© Klau|s|ens
8.9.2008, Montag, Arp Museum Bahnhof Rolandeck (Remagen), LIVE beim Symposium "Posthume Güsse" geschrieben. Genaue Angabe der Teilnehmer auf dem Podium siehe weiter unten. Prof. und Staatssekretär Joachim Hofmann-Göttig spricht. -- Copyright Klau|s|ens in allen Schreibwaisen und -weisen, u. a. als Klau*s*ens oder Klau#s#ens oder Klau+s+ens.
© Klau|s|ens
8.9.2008, Montag, Arp Museum Bahnhof Rolandeck (Remagen), LIVE beim Symposium "Posthume Güsse" geschrieben. Genaue Angabe der Teilnehmer auf dem Podium siehe weiter unten. Prof. Dr. Peter Raue spricht. -- Copyright Klau|s|ens in allen Schreibwaisen und -weisen, u. a. als Klau*s*ens oder Klau#s#ens oder Klau+s+ens.
ACHTUNG: Dieses Gedicht ist ein ZITATGEDICHT. Zu den Zitatgedichten von Klausens siehe: https://www.klausens.com/zitatgedichte.htm
© Klau|s|ens
8.9.2008, Montag, Arp Museum Bahnhof Rolandeck (Remagen), LIVE beim Symposium "Posthume Güsse" geschrieben. Genaue Angabe der Teilnehmer auf dem Podium siehe weiter unten. Bildhauer Johannes Brus spricht. Copyright Klau|s|ens in allen Schreibwaisen und -weisen, u. a. als Klau*s*ens oder Klau#s#ens oder Klau+s+ens.
ACHTUNG: Dieses Gedicht ist ein ZITATGEDICHT. Zu den Zitatgedichten von Klausens siehe: https://www.klausens.com/zitatgedichte.htm
© Klau|s|ens
8.9.2008,
Montag, Arp Museum Bahnhof Rolandeck (Remagen), LIVE beim Symposium
"Posthume
Güsse" geschrieben. Genaue Angabe der Teilnehmer auf dem Podium
siehe
weiter unten. Copyright Klau|s|ens in
allen Schreibwaisen und -weisen, u. a. als Klau*s*ens oder Klau#s#ens
oder Klau+s+ens.
ACHTUNG: Dieses Gedicht ist ein ZITATGEDICHT. Zu den Zitatgedichten von Klausens siehe: http://www.klausens.com/zitatgedichte.htm
© Klau|s|ens

Von Bernward Althoff, 08.09.08, 20:25h
Bei
der Diskussion um "posthume Nachgüsse" von Skulpturen gehts nicht
um
feingeistiges Parlieren auf Wolke sieben, sondern um viel Geld. Was ist
ein Original, was ein Nachguss, eine Reproduktion oder gar
Fälschung?
Bei
dieser "Gemengelage" verwundert es nicht, dass gestern das
öffentliche
Symposium um "Posthume Güsse" im Arp-Museum Rolandseck rund 200
Gäste
in den Meier-Bau lockte. Das Museum, "gebranntes Kind" in Sachen
Nachgüssen, hatte mit dieser Veranstaltung die Flucht nach vorne
angetreten. Das gilt es zu loben, freilich kam das Haus und die oft
kritisierte Qualität seiner 400 Werke umfassenden Arp-Sammlung
nicht
ungeschoren davon.
Arp-Experte Gert Reising rechnete anhand der "Stern"-Skulptur von Hans
Arp penibel nach, dass von zwölf
existierenden Formen (Marmor und Metall) nur drei als "gesichert"
gelten, also von Hans Arp zu Lebzeiten mit dem Einverständnis
eines
Gusses versehen wurden. "Die Herkunft aller anderen Formen ist dubios",
befand Reising.
Was für Arp gilt, gilt auch für Barlach,
Lehmbruck, Maillol, Rodin oder auch Henry Moore. Ursel Berger, Leiterin
des Berliner Kolbe-Museums, stellte fest: "Posthume Güsse und
Nachgüsse
gibt es von allen Künstlern." Sie sprach von einer "Grauzone", in
der
man sich befinde. "Händler, Kunstsammler, aber auch Kunstkritiker
sollten nicht blindwütig polemisieren, sondern sorgfältig
prüfen." Der
Kunstkritiker Eduard Beaucamp empfiehlt, dass man sich in Deutschland,
wo Kunsthandel und Museen bisher eher lax mit der Herkunft von
Güssen
umgingen, ein Beispiel an den USA nehmen solle, wo bereits seit den
frühen 70er Jahren eine akribische Erforschung von Güssen
vorgenommen
werde. "So wird eine wundersame Werkvermehrung wie im Falle Arp
verhindert."
Der Bonner Rechtsanwalt und Vorstandsmitglied von VG
Bild-Kunst, Gerhard Pfennig, zitierte aus dem Urheberrechts-Gesetz:
"Beim Werk handelt es sich um eine persönlich geistige
Schöpfung, beim
Original um ein Werk mit persönlicher Mitwirkung des Urhebers."
Pfennig
erwähnte ein Zitat von Werner Spies: "Picasso pinkelte auf seine
Plastiken, um eine Patinierung zu erreichen."
Was nach dem Tode eines Künstlers entstehe, sei kein Original mehr. Freilich handele es sich aber bei posthumen Nachgüssen nicht automatisch um bloße Reproduktionen, sondern um Kunstwerke, die dem Original nahe kämen. Summarisch erklärte Gerhard Pfennig: "Eine Deklarierung des Gusses ist wichtig, Klarheit und Wahrheit." Letzteres sollten sich besonders die Nachlass-Erben ins Stammbuch schreiben, die oft nach Jahrzehnten noch mit massenhaften Nachgüssen dubioser Herkunft noch mal richtig abkassieren würden.
Auch Lempertz-Inhaber Henrik Hanstein
forderte genaue Anweisungen von Künstlern und Erben zum Umgang mit
der
Kunst: "Der Kunsthandel kann ja schwer genauer sein als die Urheber."
So blieb, auch nach der Podiumsdiskussion, eine zentrale Forderung: die
nach Transparenz.
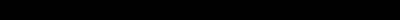
Von Thomas Kliemann
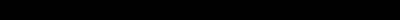
Ab sofort ist die neu errichtete
Landes-Stiftung Arp Museum Bahnhof Rolandseck
mit Sitz in Remagen-Rolandseck Betreiber des Arp Museum Bahnhof
Rolandseck.
Vorstand
Vorsitzender: Prof. Dr. Joachim Hofmann-Göttig
Stellv. Vorsitzender: Dr. Hans Friderichs
Frau Ariane Fellbach Stein
Frau Renate Kreckel
Herr Thomas Metz
Kooptierte Mitglieder
Landrat Dr. Pföhler
Bürgermeister Georgi
Stiftungsurkunde und Satzung der Landes-Stiftung Arp
Museum Bahnhof Rolandseck
Weitere Informationen:
Sabine Töpke, Tel. 02228-942511, Fax 02228-942521,
e-mail: toepke[[AT]]arpmuseum.org
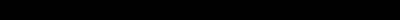
Einigung zu Arp: Land Rheinland-Pfalz und Stiftung Hans Arp
und Sophie Taeuber-Arp e.V. beenden alle Auseinandersetzungen
Mainz/Remagen-Rolandswerth, 02. Juli 2008 -
Das Land Rheinland-Pfalz und die Stiftung Hans Arp und Sophie
Taeuber Arp e.V. haben eine Einigung im Sinne der Kunst getroffenund
ihren Streit beendet. Betrieb und Unterhalt des im September 2007
eröffneten Arp Museum Bahnhof Rolandseck liegen fortan alleinin
der
Verantwortung des Landes.
Die erzielte Einigung hat folgende Eckpunkte:
gez. Stiftung Hans Arp und Sophie Taeuber-Arp e.V.
gez. Land Rheinland-Pfalz
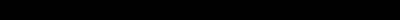
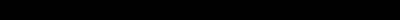
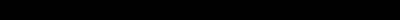
Bonn/Baden-Baden - "Viertel nach sechs" am
Samstag, den 22. September 2007, 18.15 Uhr im SWR Fernsehen
Das ehrgeizige Kulturprojekt des Landes
Rheinland-Pfalz steht kurz vor der Vollendung: das Arp-Museum in
Rolandseck am Rhein. Alles scheint perfekt: ein spektakulärer
Museumsbau (Gesamtkosten: rund 33 Millionen Euro) des internationalen
Stararchitekten Richard Meier für Hans Arp, den weltberühmten
Künstler.
Aber der Schein trügt: Die Qualität der Kunstsammlung des
Museums ist
umstritten, es gibt Diskussionen über die Echtheit einzelner
Stücke.
Außerdem sind die langfristige Konzeption und Finanzierung
unklar. Eine
Woche vor der Eröffnung am 29. September bringt der SWR in einer
Dokumentation von Thomas Leif und Ulrich Paulus neue Beweise zum
umstrittenen Umgang mit den Werken Hans Arps.
Fragwürdige Verkaufspraxis des Arp-Vereins
Der
maßgeblich am Arp-Museum in Rolandseck beteiligte Verein
"Stiftung Jean
Arp und Sophie Taeuber-Arp e.V." (Arp-Verein) verfolgt als
Satzungszweck den Verkauf von Arp-Duplikaten. Dies berichtet das SWR
Fernsehen unter Berufung auf die im Amtsgericht Bonn eingesehene
Originalsatzung des "Arp-Vereins"." Wörtlich heißt es in
Paragraph 1
der Satzung: "Werke von Arp und Taeuber-Arp zur ständigen
Finanzierung
der Stiftung zu verkaufen bzw. zu tauschen. Beim Verkauf wird vor allem
an Duplikate gedacht."
Auf die Frage, ob der Verkauf von
Arp-Duplikaten ein Satzungsziel des Arp-Vereins sei, antwortete die
Generalsekretärin des Arp-Vereins, Maja Stadler-Euler, in einer
schriftlichen Stellungnahme vom 31. August 2007: "In der Satzung geht
es bei den "Duplikaten" um "zweimal vorhandene" Güsse. Diese
"Duplikate" können zur Finanzierung der Stiftung verkauft werden,
damit
keine Lücken in der Sammlung entstehen." Diesen Handel mit
Kunst-Kopien
bewertete der Geschäftsführer der Verwertungsgesellschaft
Bild, Dr.
Gerhard Pfennig, gegenüber dem SWR so: "Duplikat ist begrifflich
genau
das Gegenteil von Original." Indem der Arp-Verein sagt, "er will
Duplikate verkaufen, sagt er, er macht einen Handel mit Reproduktionen
auf."
Qualitäts-Beanstandungen schon vor dem
Fälschungsskandal von 1997
Der
SWR deckt auf, dass das Land Rheinland-Pfalz bereits vor dem bekannten
Fälschungsskandal von 1997 acht Plastiken des Arp-Vereins im Wert
von
mehr als einer Million Euro beanstandete. Bereits am 8. März 1996
musste der Kaufvertrag zwischen dem Land Rheinland-Pfalz und dem
Arp-Verein nachträglich geändert und der Verkaufspreis um
"2.340.000,- DM" reduziert werden.
Das Land gab acht Plastiken auf Grund
zweifelhafter Qualität zurück. Dies geht aus dem Protokoll
des
Arp-Vereins vom 24. August 1996 hervor, das dem SWR vorliegt. Bislang
war lediglich bekannt, dass nach der Skandal-Ausstellung 1997 im
Landesmuseum Mainz im März 1998 "21 vom Land angekaufte Arp-Werke
auf
Grund von Unklarheiten hinsichtlich des Originalbegriffes an den
Verkäufer (Anm.: den Arp-Verein) zurückgegeben werden", so
das
Kulturministerium. Der Arp-Verein wollte sich zu dieser bislang
unbekannten Rückruf-Aktion erst nach der Eröffnung des
Arp-Museums am
29. September 2007 äußern. Ein Sprecher des
Kulturministeriums
bestätigte den Vorgang.
Gefälschte Marmorplastik wird immer noch
im Depot in Düsseldorf aufbewahrt
Besonders
fragwürdig ist, dass beanstandete Werke bis heute nicht aus dem
Verkehr
gezogen wurden. So wird die nachweislich gefälschte Marmor-Plastik
"Blatt-Torso" (234 x 54,5 x 38) immer noch im Kunst-Depot des Landes
Rheinland-Pfalz in Düsseldorf aufbewahrt.
Umstritten sind weiter 49 posthume
Nachgüsse
von Arp-Werken, auf deren Produktion der Arp-Verein besteht. Frau
Stadler-Euler bekräftigte gegenüber dem SWR die Notwendigkeit
dieser
Nachgüsse. Nach ihrer Einschätzung sind "zwei Drittel aller
Skulpturen
in den großen Museen dieser Welt posthume Güsse." Dr.
Gerhard Pfennig
wandte sich gegen diesen Umgang mit dem Lebenswerk von Hans Arp: "Sonst
könnten sie auch statt Originalgemälden nachgemalte Bilder
zeigen oder
Reproduktionen oder andere Vervielfältigungen." Gegenüber dem
SWR
bestätigte der Arp-Verein erstmals schriftlich, dass die
wiederholt
angekündigte Expertenkommission zur Überprüfung des
umstrittenen
Arp-Bestandes mit mehr als 3000 Werken bis heute nicht eingesetzt
worden ist. Wörtlich heißt es: "Die Aufgabe der Berufung
einer solchen
Kommission liegt beim Direktor. Sie wurde vom Vorgänger von
Professor
Gallwitz nicht durchgeführt."
Der SWR zeigt die 30-minütige
Dokumentation
"Kunsttempel oder Luftschloss? Der Kampf ums Arp-Museum" von Thomas
Leif und Ulrich Paulus am Samstag, 22. September 2007 um 18.15 Uhr im
SWR Fernsehen.
Bei Fragen wenden Sie sich bitte an Dr. Thomas
Leif,
Tel.: 0171-9321891, Ulrich Paulus, Tel.: 06131-929-3268, oder Rainer
Brenner, Tel.: 06131/929-3268.
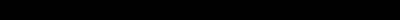
| Plagiarp am Rolandseck | |||
| - | Das Arp-Museum in Rheinland-Pfalz zeigt umstrittene Werke - und Plagiate | ||
| - | |||
| - |
|
||
| - | |||
| - |
|
||||
| - | |||||
| - |
|
||||||||
| - | |||||||||
| - |
|
|||
| - | ||||
| - |
|
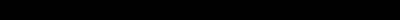
Kurz bevor Rheinland-Pfalz am Rolandseck
an diesem Freitag ein Museum
eröffnet, das dem Bildhauer Hans Arp gewidmet ist, lodert ein
alter
Streit weiter. Das Land hatte etwa 400 Arp-Stücke für zehn
Millionen
Euro von dem privaten Arp-Verein angekauft. Doch nicht alle Werke sind
echt.
Er dreht sich um gegründete und nicht gegründete
Stiftungen, um posthume Güsse und eine Sammlung, für die das
Land Rheinland-Pfalz zehn Millionen Euro hinblätterte. Ein vor
wenigen Tagen im SWR ausgestrahlter Filmbeitrag von Thomas Leif und Uli
Paulus rollt den Kunstkrimi um das Arpsche Erbe noch einmal auf. Zu
Recht, denn viele Fragen, die bis zur Premierenschau des Neubaus
(Architekt: Richard Meier) hätten geklärt sein müssen,
sind weiterhin ungelöst.
Die Zukunft des rheinland-pfälzischen Prestige-Objekts (Kosten:
33 Mio. Euro) ist unsicher, sein Ruf steht auf dem Spiel. Denn hinter
der strahlenden Verpackung verbirgt sich ein womöglich nicht ganz
einwandfreier Inhalt: Wie wertvoll sind die Arp-Werke, die dort gezeigt
werden? Entsprechen sie internationalen Museumsstandards? Sind sie
allesamt authentisch, das heißt zu Lebzeiten des Künstlers
von ihm selbst kontrolliert?
Oder sind darunter auch nach seinem Tod gegossene Arbeiten, die auf
dem Kunstmarkt geringer honoriert werden als Originale, die Arp selber
schuf? Hat das Land – und damit der Steuerzahler – vielleicht einen zu
hohen Preis bezahlt? Wird dem Besucher Echtheit vorgegaukelt, wo in
Wahrheit eine nicht verbriefte Variante steht?
Das umstrittene "Tanzgeschmeide" setzt ein erstes fragwürdiges
Signal. Die weithin sichtbare Plastik im Außenbereich, geschickt
platziert als Werbesignet, ist ein posthumer (mithin geringwertiger)
Guss, zudem lediglich vergrößerte Nachbildung eines
Arp-Entwurfs. Den Segen des Künstlers hat sie nicht. Ein Auftakt,
der, streng genommen, in die Irre führt.
Für weitere Irritation sorgt eine Bemerkung aus ministeriellem Munde. Obwohl der (Übergangs)-Direktor des Hauses, Klaus Gallwitz, stets beteuert, unter seiner Ägide werde es keine Nachgüsse geben, hält sich die Politik alle Optionen offen: "Auf Nachgüsse wird nicht grundsätzlich verzichtet", verkündete Staatssekretär Joachim Hofmann-Göttig noch im August.
Eine Expertenkommission, die das Problem schon vor Jahren
erörtern sollte, wurde nie einberufen. Laut Gallwitz soll dies
demnächst "vor Ort und im Anblick der Objekte" geschehen. Ob man
das Versprechen diesmal halten wird? Inzwischen haben jedenfalls nahezu
alle Beteiligten an Glaubwürdigkeit verloren.
Vor allem der Arp-Verein steht immer wieder in der Schusslinie der
Kritik. Gegründet von dem inzwischen verstorbenen Johannes
Wasmuth, ist er im Besitz der Gussrechte, die es ihm ermöglichen,
Arp-Bronzen auf dem Kunstmarkt nach Bedarf und auf Nachfrage zu
verkaufen.
Was fehlt, ist indes eine Dokumentation der Verkäufe – und der
Bestände, die hinter verschlossenen Depottüren lagern. "Wir
sind zur Rechenschaft nicht verpflichtet", heißt es dazu lapidar
aus dem Munde der Generalsekretärin und Juristin Maja
Stadler-Euler. Warum diese Geheimniskrämerei?
Doch die hat geradezu Tradition. Erst durch beharrliche Recherchen
kamen in den 90er Jahren die näheren Umstände der
Vereinsgründung ans Licht der Öffentlichkeit. Wasmuth hatte,
so urteilen Insider, der Arp-Witwe Marguerite Hagenbach das Erbe des
Künstlers regelrecht abgeschwatzt. Die alte Dame erwartete
dafür die Gründung einer Stiftung in Frankreich, wo der
Künstler lange Zeit lebte.
Wasmuth aber brachte die Objekte in seine Heimat, wo er mit dem
Kulturbahnhof Rolandseck einen Treffpunkt betrieb, der Prominente wie
Politiker lockte. Hier träumte er von einem gläsernen
Museumsbau, durch den die Züge fahren, hier gründete er einen
Stiftungsverein, der seine Wandlung zur echten Stiftung bis heute nicht
vollzogen hat. Und hier wurde letzten Endes auch ein Vertrag zwischen
Land und Verein eingefädelt, der das Land zum Geldgeber
degradierte, während er dem Verein alle Gestaltungsspielräume
gewährte.
Erst 2005 wurde – nach entsprechenden Medienberichten – der dubiose
Vertrag geändert. Formal bestimmen nun das Land und die neue
"Stiftung Arp Museum Bahnhof Rolandseck" die Geschicke des Museums. Im
Vorstand: neben Staatssekretär Hofmann-Göttig und Ex-MdB Hans
Friderichs: Maja Stadler-Euler vom Arp-Verein.
Gemeinsam setzt das Trio auch den künstlerischen Leiter ein.
Dass es sich nur zu einer Zwischenlösung durchringen konnte,
nachdem der erste Gründungs-Chef allzu kritisch auftrat, spricht
Bände " und wirft die Frage nach dem Nachfolger auf. Der
entscheidende Deal ist allerdings längst über die Bühne
gegangen: Für zehn Millionen Euro kaufte das Land Kunst vom
Verein, um diesen zu entschulden.
Eine genaue Sichtung der Erwerbungen führte jedoch 1997 zu
einem erschreckenden Befund: 21 Werke hielten der Echtheitsprüfung
nicht stand. Der TV-Journalist Thomas Leif recherchierte jetzt, was
damit geschah und fand heraus: Die Fälschungen wurden keineswegs
vernichtet. Vier von acht beanstandeten Marmorplastiken befinden sich
sogar immer noch in Landesbesitz.
Verwunderlich erscheint im Nachhinein auch, dass der
Kunsthändler Hans Otmar Neher bei diesem Geschäft nicht
stutzig wurde: Er schätzte den Wert der betreffenden Werke. Eine
weitere Überraschung ist das Ziel der Vereinssatzung, die Leif
beim Bonner Amtsgericht eingesehen hat. Zur ständigen Finanzierung
des Vereins werde beim Verkauf von Arp-Werken "vor allem an Duplikate
gedacht", heißt es in Paragraph 1.
Duplikat ist aber "begrifflich genau das Gegenteil von Original",
klärt Gerhard Pfennig, Geschäftsführer der VG Bild auf.
"Wer Duplikate verkaufen will, macht einen Handel mit Reproduktionen
auf." Braucht ein "Museum der Superlative" (Hofmann-Göttig) nicht
seriösere Partner?
Angesicht der jüngsten Enthüllungen ist weiterhin
äußerste Skepsis angebracht. Klaus Gallwitz mag auf seinem
Standpunkt beharren, dass er "Wichtigeres zu tun" hatte, als sich um
postume Güsse zu kümmern. Doch was geschieht nach seinem
Abgang? Wer wird ab 2008 das neue Haus mit welchem Konzept in die
Zukunft leiten? Und kann dieses Museum überhaupt dem Künstler
gerecht werden, dessen Namen es trägt? Mit der schönen
Aussicht ist es nicht getan.
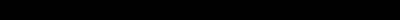




SERIELLO
Jahrestagung Kultur- und Kreativwirtschaft |
Gedichte
in und um Nizza |
Walther
von
der Klausens 124 LIVE-Gedichte |
KLAUSENS
und Franz Müntefering |
KLAUSENS
und WOLF HAAS |
SERIELLO
Rüdiger Safranski |
JETZTROMAN
von
Jean-Luc Klausens |
Klausens
und Ulrich Wickert |
Klausens
und der Friedenspreis des Deutschen Buchhandels |
SERIELLO
Tony Cragg |
Klausens
und Tony Cragg |
SERIELLO
Stefan Gronert |
SERIELLO
Schlichtung Stuttgart 21 erster Tag |
SERIELLO
Die Sonne von Bad Kreuznach |
KLAUSENS
und Urs Widmer |
Klausens
LIVE-Zeichnungen |
Klausens
und Josef Wilfling |
Klausens
und Jürgen Domian
|
Nur die
Links |
SERIELLO
Alida Kurras |
SERIELLO
Name June Paik "Mercury" |
Neues
Rheinland |
SERIELLO
Markus Heinzelmann|
Irene
Ludwig | SERIELLO
Stefanie Kreuzer | Nam June
Paik And My Fotografic Darkness In The Laser Cone | KLAUSENS
Jahresgabe BONNER KUNSTVEREIN 2010 | SERIELLO
Schlichterspruch Heiner Geißler Stuttgart, letzter Tag | SERIELLO
Stephan Speicher Pavel Kohout | KLAU~S~ENS
UND JOSEF HASLINGER | KLAUSENS
und das ganze Bonner Theater einer Oper zum Gedicht | SERIELLO
MITTERNACHTSMESSE (Christmette) ROM WEIHNACHTEN Vatikan Petersdom Papst
et al. | SERIELLO
LEBKUCHENHAUS WEIHNACHTSMARKT | Autogedichte
| SERIELLO
Ulrich Khuon | Peo |
SERIELLO
Stephan Speicher Pavel Kohout | Taschenrechner
Online | Christmette
KÖLNER DOM | SERIELLO
Guido Westerwelle | SERIELLO
Mirga Grazinyte | SERIELLO
Fischgrätkunstprofil | KLAU&S&ENS
und Dirk Luckow | EI | HEILIG –
10 Jahre WIKIPEDIA | SERIELLO
Beuys: Das unbestimmte Etwas als Unsbestimmtes | SERIELLO
Beuys und das Foyer der Kunstsammlung NRW | KLAU:S:ENS
und Anke Engelke | SERIELLO
Ingrid Scheller und Martin Schumacher |
DENKQUIEM
FÜR DEN DIKTATOR BEN ALI VON TUNESIEN |
KLAUSENS
und GEDOK und BIRTHE BLAUTH |
KLAUSENS
und die MUSIKFABRIK |
KLAUSENS
und DIETER MACK |
KLAUSENS
und die Arbeitsmarktkonferenz Medien und Kultur |
SERIELLO
Trauerfeier Bernd Eichinger |
ABSCHIED
von BERND EICHINGER |
SERIELLO
Aufruhr in Ägypten |
AUFRUHR
in ÄGYPTEN |
SERIELLO
Mubarak und die letzte Rede |
SERIELLO
Martina Gedeck |
Klau"s"ens
und Karl-Theodor zu Guttenberg |
Klau=s=ens
und Christoph Schreier und Gregor Jansen |
Klau°*°s°*°ens
und die AKW-KKW-Atomkatastrophe |
Klau;s;ens
und Helmut Krausser |
SERIELLO
Helmut Krausser |
Klau/s/ens
und Giovanni di Lorenzo und Axel Hacke |
SERIELLO
Giovanni di Lorenzo und Axel Hacke |
Klau*s*ens
und Wolfgang Hohlbein |
SERIELLO
Ayako Rokkaku |
SERIELLO
Eröffnung Willy-Brandt-Forum in Unkel |
Klau:s:ens
und Franz König und Carmen Strzelecki |
SERIELLO
Michael Ballack |
Klau+s+ens
und Präses Nikolaus Schneider |
SERIELLO
Anmarsch Training BAYER LEVERKUSEN |
Klau+s+ens
und der selige Papst |
Klau°s°ens
und die Tontalente in Düsseldorf |
Aktionärsgedichte
HOCHTIEF |
European
Song Contest ESC |
Autobahn-Ras-Videos
|
Klausens
und Peter Kurzeck |
SERIELLO
Peter Kurzeck und Insa Wilke |
SERIELLO
Jürgen Milski |
SERIELLO
Sendeschluss CALL-IN bei 9LIVE |
SERIELLO
Letzter Tag CALL-IN Quizzo bei 9LIVE |
Klau"s"ens
und eine Professorin |
Klau"s"ens
und ein Professor |
HANS -
Protestkunstwerk gegen die FACEBOOK-Gesichtserkennung |
Klau:s:ens
und Durs Grünbein |
Klau_s_ens
und Herta Müller |
SERIELLO
Herta Müller Ernest Wichner |
Schulreform
|
SERIELLO
Sylvia Löhrmann |
SERIELLO
Stadiondach |
So und so
viele Menschen KUNSTWERK |
SERIELLO
Mein Finger am Auslöser zur Fotografie zwischen Dokumentation und
Inszenierung |
Klau|_|s|_|ens
und Herta Wolf |
REALGEDICHT
Ungepflegte Gräber |
Klau;s;ens
und Karl Heinz Götze |
SERIELLO
Loveparade Poster Kondolenz Wut |
SERIELLO
Stau auf der Autobahn |
Verhör
und Uhrzeit |
SERIELLO
Afrika durch das Fenster |
Mauer
|
Bei
Bayreuth bei |
Mehr-Reichtums-Theorie
|
Klausens
und der große Kölner Kunstfälscherprozess |
An die
Zerstörer |
Klausens
und Hélène Grimauld |
Klausens
und die Blog-Einträge zum Heinrich-Boere-Prozess |
Doku-Gedicht
Berliner Runde Wahl Mecklenburg-Vorpommern |
Realgedichte
2 |
FACEBOOK-Sabber-Projekt
|
SERIELLO
Günter Grass |
Klau²s²ens
und Günter Grass |
Klau=s=ens
und Bob Dylan |
SERIELLO
Die Nachrichtensprecherin |
Ungesehene
Tränen |
Klau&s&ens
und Mark Knopfler |
Geldgedichte
|
Klausens
Beiträge in OPINIO RHEINISCHE POST |
DOKU-Gedicht
Berliner Runde WAHL Berlin |
EINIGE
ERINNERUNGEN an geschlossene Plattformen im Internet |
NUNROMAN
[11.11.11] |
SERIELLO
Schallschutzwand Lärmschutzwand |
Klausens
und das Betreuungsrecht |
Klopfeiferserenade
|
Klau:s:ens
und die russische Pianistin |
Klau§s§ens
und Hans-Dietrich Genscher |
Klau((s))ens
und Kasper König vor dem Gesetz |
SERIELLO
Péter Esterházy |
Klau=s=ens
und Péter Esterházy |
SERIELLO
Kasper König |
SERIELLO
Außenbanner "Vor dem Gesetz" |
Silvester
|
Medizingedichte
und Arztgedichte |
SERIELLO
Annegret Kramp-Karrenbauer |
Realgedicht
KOMPARSE |
Klau.s.ens
und Bodo Hombach |
SERIELLO
Marcel Reich-Ranicki
im Deutschen Bundestag
27.1.2012 |
SERIELLO
ZIMMER DETAILS SONNE WINTER NACHMITTAG |
Klausens
MEINATLASCOLLAGE zu Gerhard Richter zum 80. Geburtstag |
Klau§s§ens
und Christian Wulff |
SERIELLO
Wahl Christian Wulff |
SERIELLO
NATO STACHEL DRAHT |
MESSERKUNDE
|
KLAU"S"ENS
und ERDMÖBEL |
Klausens
und Elfi Scho-Antwerpes |
Abgehackte
Bäume in Königswinter |
Seriello
Pressekonferenz
Kanzleramt: Gauck wird es |
REALGEDICHT
Schlecker-Schließungsliste |
Klau=s=ens
und Walter Dahn
und Stephan Reusse und Ulrich Pester |
SERIELLO
Ende Prozesstag Eins gegen Massenmörder Breivik |
Kunstprojekt
Auswärtsfahne |
Klau's'ens
und Wolfgang Bosbach |
Gedicht
ohne Urheberrecht |
SERIELLO
Rheinwasser |
DFB-Neutrainer-Turnier
zu Hennef |
!SING –
Day of Song |
KLAUSENS
K-WERK bei GOOGLE-BILDER-SUCHE |
KLAUSENS
KUNSTWERK bei GOOGLE-BILDER-SUCHE |
SERIELLO
Venus Mond |
SERIELLO
Sepp Blatter |
LUSTIGE
und KOMISCHE und SELTSAME GEDICHTE |
SERIELLO
Schattenwandbilder |
Sumpfweg-Gedichte
|
SERIELLO
documenta-13 Touched |
SERIELLO
documenta 13 documenta-Halle Teil 1 |
SERIELLO
documenta 13 documenta-Halle Teil 2 |
A Piece
of Rectangle Art |
SERIELLO
documenta 13 Unterführung |
Das
gekaufte Gedicht und das zu kaufende Gedicht |
273 x 12
Rhein-Cage-Projekt |
Klau:s:ens
und Richard Meier |
SERIELLO
Helmut Kohl |
Klau~s~ens
und Bodo Kirchhoff |
 GEDICHTE
GEDICHTE VERÖFFENTLICHUNGEN
VERÖFFENTLICHUNGEN KUNST
KUNST  SERIELLOS
SERIELLOS AKTIONEN
AKTIONEN PROSA
PROSA BÜCHER
BÜCHER VIDEOS
VIDEOS SONSTIGES
SONSTIGES
KLAUSENS TRIFFT AUF KÜNSTLER * KLAUSENS TRIFFT AUF LITERATEN * KLAUSENS TRIFFT AUF POLITIKER * KLAUSENS TRIFFT AUF PROFESSOREN * KLAUSENS TRIFFT AUF PROMINENTE SCHAUSPIELER SONSTIGE * KLAUSENS TRIFFT AUF SPORTLER * KLAUSENS TRIFFT AUF MUSIKER
START | GEDICHTE | BÜCHER | KUNST | SERIELLOS | AKTIONEN | AUDIO-CDs | STARTSEITE | WEBLOG | SUCHE | PROSA | VIDEOS | SONSTIGES | VERÖFFENTLICHUNGEN | ALPHABETISCH A-Z | DICHTBLOGGER | HOME | LIVE-Gedichte | Nur die Links | EIGENWORTLEXIKON | BLOG-ARCHIV: Alle Beiträge | GEDICHT-BLOG-ARCHIV | ZITATGEDICHTE | HOME | einige-von-klausens-live-bedichtete-personen

Klausens-BÜCHER
Siehe u. a. auch
die Reihe der Datumsromane: STUNDENROMAN
[9.9.9.]
* NUNROMAN
[11.11.11] *
HULSK-KURZUMROMAN
*
EINTAGESROMAN
[8.8.8]
* JETZTROMAN
[10.10.10]
* BALDROMAN [12.12.12]
* SCHONROMAN [3.3.13]
* HEUTROMAN [4.4.14]
* DIENSTAGSROMAN
[5.5.15]
* DOCHROMAN
[6.6.16]
* FREITAGSROMAN
[7.7.17]
* HITZEROMAN
[8.8.18]
* TAGESROMAN
[9.9.19]
* COVID-19-ROMAN
[10.10.20]
* DONNERSTAGSROMAN
[11.11.21]
* MONTAGSROMAN
[12.12.22]
* DASEINSROMAN
[3.3.23]
* SONNTAGSROMAN
[14.4.24]
* ÜBERBLICK
DATUMSROMANE
*
********* Was
man über
Klausens (nicht) wissen muss
*********
Einige
von Klausens live
bedichtete Personen | Nur die
Links = Alle Links |
| Veröffentlichungen
|
DIE TAGESROMANE (oder auch DATUMSROMANE)
von Klausens sind von
folgenden Tagen
-- und auch an eben diesen geschrieben
worden !!! --
14.4.2024: SONNTAGSROMAN [14.4.24],
erschienen im April 2024 =
siebzehnter Datumsroman =
17. Tagesroman
3.3.2023: DASEINSROMAN [3.3.23], erschienen
im März 2023 =
sechzehnter Datumsroman =
16. Tagesroman
12.12.2022: MONTAGSROMAN [12.12.22],
erschienen im Dezember 2022 =
fünfzehnter Datumsroman =
15. Tagesroman
11.11.2021:
DONNERSTAGSROMAN [11.11.21], erschienen im November 2021 =
vierzehnter Datumsroman =
14. Tagesroman
10.10.2020: COVID-19-ROMAN [10.10.20],
erschienen im Oktober 2020 =
dreizehnter
Datumsroman
= 13. Tagesroman
9.9.2019: TAGESROMAN [9.9.19], erschienen
im September 2019 =
zwölfter
Datumsroman
= 12. Tagesroman
8.8.2018: HITZEROMAN [8.8.18], erschienen
im August 2018 = elfter
Datumsroman
= 11. Tagesroman
7.7.2017: FREITAGSROMAN [7.7.17],
erschienen im Juli 2017 = zehnter
Datumsroman
= 10. Tagesroman
6.6.2016: DOCHROMAN [6.6.16], erschienen im
Juni 2016 = neunter
Datumsroman
= 9. Tagesroman
5.5.2015: DIENSTAGSROMAN [5.5.15],
erschienen im Mai 2015 = achter
Datumsroman
= 8. Tagesroman
4.4.2014: HEUTROMAN [4.4.14], erschienen im
April 2014 = siebter
Datumsroman
= 7. Tagesroman
3.3.2013: SCHONROMAN [3.3.13], erschienen
im März 2013 = sechster
Datumsroman
= 6. Tagesroman
12.12.2012: BALDROMAN [12.12.12],
erschienen im Dezember 2012 =
fünfter Datumsroman
= 5. Tagesroman
11.11.2011: NUNROMAN [11.11.11], erschienen
im November 2011 = vierter
Datumsroman
= 4. Tagesroman
10.10.2010: JETZTROMAN [10.10.10],
erschienen im Oktober 2010 = dritter
Datumsroman
= 3. Tagesroman
9.9.2009: STUNDENROMAN [9.9.9], erschienen
im September 2009 = zweiter
Datumsroman
= 2. Tagesroman
8.8.2008: EINTAGESROMAN [8.8.8], erschienen
August 2008 = erster
Datumsroman
= 1. Tagesroman
| Nur die
Links = Alle Links |
| Veröffentlichungen
|



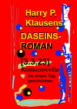





















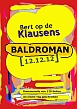

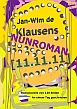







Klau|s|ens ist Klausens ist Klau(s)ens ist Klau's'ens ist Klau/s/ens ist Klau1s1ens ist Klau[s]ens ist Klau*s*ens ist Klau-s-ens ist Klau#s#ens ist Klau³s³ens ist Klau²s²ens ist Klau§s§ens ist Klau:s:ens ist Klau_s_ens ist Klau=s=ens ist Klau?s?ens ist Klau+s+ens ist Klau~s~ens ist Klau@s@ens ist Klau!s!ens ist Klau°s°ens ist Klau"s"ens ist Klau§s§ens ist Klau$s$ens ist Klau!s!ens ist Klau?s?ens ist Klau"s"ens ist Klau\s\ens ist Klau&s&ens ist Klau1s1ens ist Klau.s.ens ist Klau,s,ens ist Klau2s2ens ist Ist-Klausens ist Zweitklausens ist Drittklausens ist Viertklausens ist Fünftklausens ist Sechstklausens ist Siebtklausens ist Achtklausens ist Neuntklausens ist ... Klaus Ist-Klausens ... Klaus K. Klausens ... Klaus Klausens-Achtlinger ... und seit dem 4.2.2008 auch Weltkulturerbe.
KLAUSENS in der DNB
KLAUSENS
in der Zeitschriftendatenbank ZDB
KLAUSENS
im Literaturport
KLAUSENS in MARBACH: Die Blog-Plattform des Blogbetreibers BLOGG.DE
wurde allerdings 2016 geschlossen.
A) WEBLOG BLOGG.DE Log Weltling http://literatur-im-netz.dla-marbach.de/zdb2508886-5.html
B) DICHT.BLOGG http://literatur-im-netz.dla-marbach.de/zdb2554606-5.html
C) KLAUSENS BLOG WORDPRESS http://literatur-im-netz.dla-marbach.de/zdb2758552-9.html
KLAUSENS
bei TWITTER alias X ||| Weblog von
KLAUSENS ||| Klausens trifft auf Literaten
START | GEDICHTE | VERÖFFENTLICHUNGEN | KUNST | SERIELLOS | AKTIONEN | AUDIO-CDs | STARTSEITE | WEBLOG | SUCHE | PROSA | VIDEOS | SONSTIGES | BÜCHER | ALPHABETISCH A-Z | DICHTBLOGGER | HOME |LIVE-Gedichte | Nur die Links |
KONTAKT: info [ÄTT] klausens.com | Alle meine Twitter-Gedichte, gesammelt
www.klausens.com/klausens_alphabetisch.htm

 SUCHE
nur auf KLAUSENS.COM | Hier oben da drin in dem weißen Feld
ausschließlich die gesamte Homepage / Website von Klausens
durchsuchen! Umlaute für ältere Sites mit anderem Zeichensatz
auch mal als ae und ue und oe schreiben! Und dann "ß" gerne auch
mal als "ss" schreiben!
SUCHE
nur auf KLAUSENS.COM | Hier oben da drin in dem weißen Feld
ausschließlich die gesamte Homepage / Website von Klausens
durchsuchen! Umlaute für ältere Sites mit anderem Zeichensatz
auch mal als ae und ue und oe schreiben! Und dann "ß" gerne auch
mal als "ss" schreiben!
Siehe
auch: KLAUSENS
TRIFFT AUF KÜNSTLER* KLAUSENS
TRIFFT AUF LITERATEN
* KLAUSENS
TRIFFT AUF POLITIKER * KLAUSENS
TRIFFT AUF PROFESSOREN
* KLAUSENS
TRIFFT AUF PROMINENTE SCHAUSPIELER SONSTIGE
* KLAUSENS
TRIFFT AUF SPORTLER
* KLAUSENS
TRIFFT AUF MUSIKER
Oder unter NUR DIE LINKS. Oder unter Alphabetisch
KONTAKT:
info
ÄTT klausens.com Klau|s|ens![]() ĦķΩ7
ĦķΩ7

WELTLING